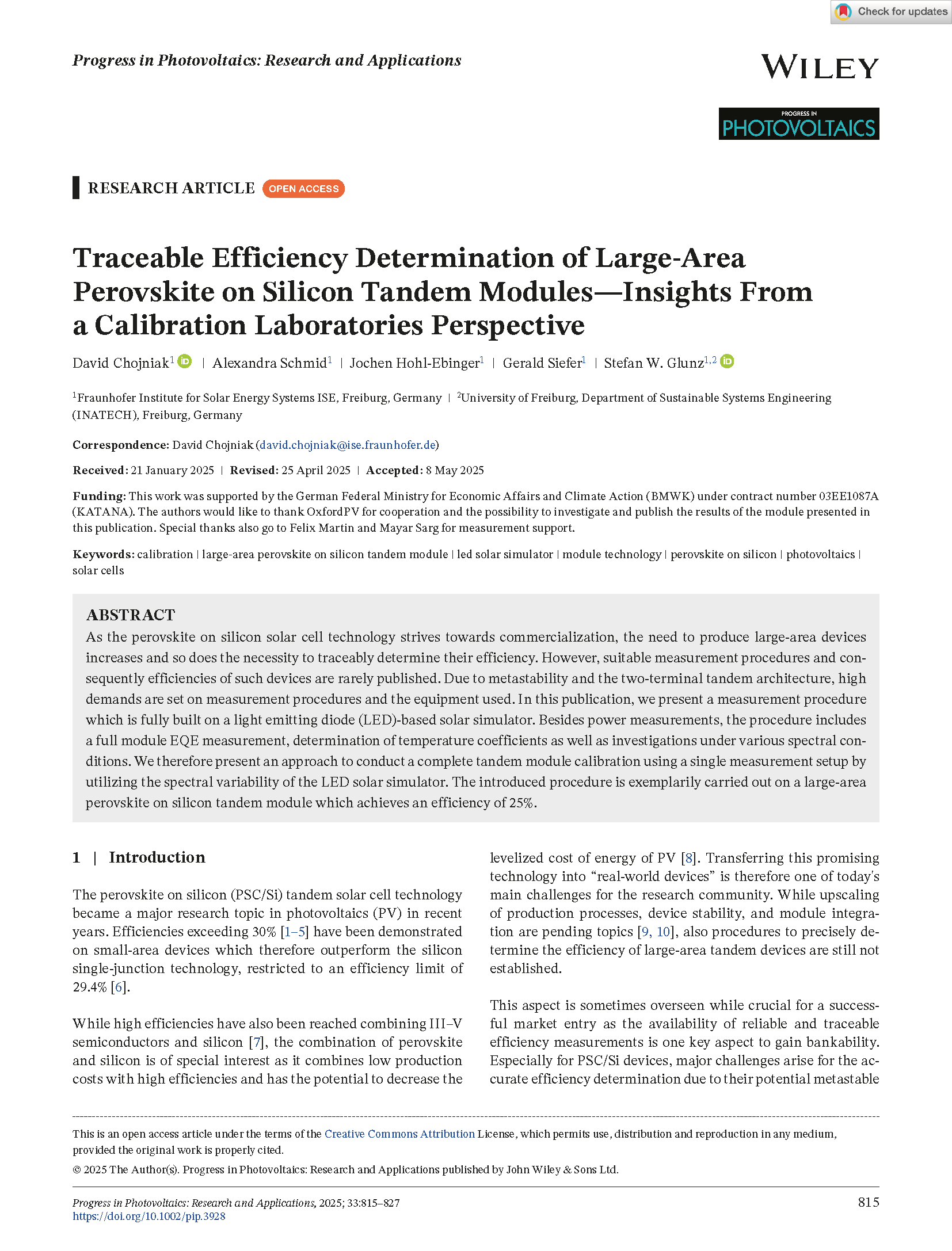SCIENCE | Volume 390 | Issue 6772 | 30 Oct 2025 | DOI: 10.1126/science.adx1745
Oussama Er-raji, Christoph Messmer, Rakesh R. Pradhan, Oliver Fischer, Vladyslav Hnapovskyi, Sofiia Kosar, Marco Marengo, Mathias List, Jared Faisst, José P. Jurado, Oleksandr Matiash, Hannu Pasanen, Adi Prasetio, Badri Vishal, Shynggys Zhumagali, Anil R. Pininti, Yashika Gupta, Clemens Baretzky, Esma Ugur, Christopher E. Petoukhoff, Martin Bivour, Erkan Aydin, Randi Azmi, Jonas Schön, Florian Schindler, Martin C. Schubert, Udo Schwingenschlögl, Frédéric Laquai, Ahmed A. Said, Juliane Borchert, Patricia S. C. Schulze, Stefaan De Wolf, Stefan W. Glunz
Perowskit-Silizium-Solarzellen sind eine vielversprechende Technologie-Route, um die Photovoltaik noch günstiger und ressourceneffizienter zu machen. Sie bieten einen Energieumwandlungswirkungsgrad (PCE) von bis zu 34,85 % bei minimalen zusätzlichen Herstellungskosten. Ihre wirtschaftliche Rentabilität hängt von industrietauglichen Zell-Architekturen ab, wie beispielsweise monolithische, vollständig strukturierte Tandems mit Standard-Siliziumpyramidengrößen (>1 μm). In dieser Konfiguration wird die Perowskit-Schicht durch einen hybriden Verdampfungs-/Spin-Coating-Prozess aufgebracht. Dabei entsteht eine strukturierte Grenzfläche, die optische Reflexionsverluste effektiv minimiert. Dennoch wird der Wirkungsgrad von Solarzellen mit dieser Architektur durch Photospannungs- und Ladungstransportverluste an der Grenzfläche zwischen Perowskit und Elektronentransportschicht (ETL) begrenzt.
Um diese Einschränkungen zu mildern, wurden im Rahmen einer optoelektrischen Simulationsstudie zwei Strategien zur Passivierung der Grenzfläche untersucht: chemische Passivierung und Feldeffektpassivierung. Letztere zeigte einen völlig neuartigen Vorteil in der Perowskit-Halbzelle: Die Elektronenakkumulation dehnt sich über die Grenzfläche hinaus in den kompletten Absorber hinein, wodurch die Leitfähigkeit verbessert und Transportverluste reduziert werden. Experimentell ergab die Anwendung von 1,3-Diaminopropandi-dihydroiodid (PDAI) an der Grenzfläche zwischen Perowskit und ETL einen Wirkungsgrad von 33,1 %, eine Leerlaufspannung von 2,01 V und eine verbesserte Langlebigkeit der Solarzellen, getestet an der Küste des Roten Meeres. Diese Ergebnisse bestätigen, dass große Pyramidenstrukturen eine effektive Passivierung nicht behindern, eine wichtige Voraussetzung für die Industrialisierung von hocheffizienten, vollständig strukturierten Perowskit/Silizium-Tandemsolarzellen.